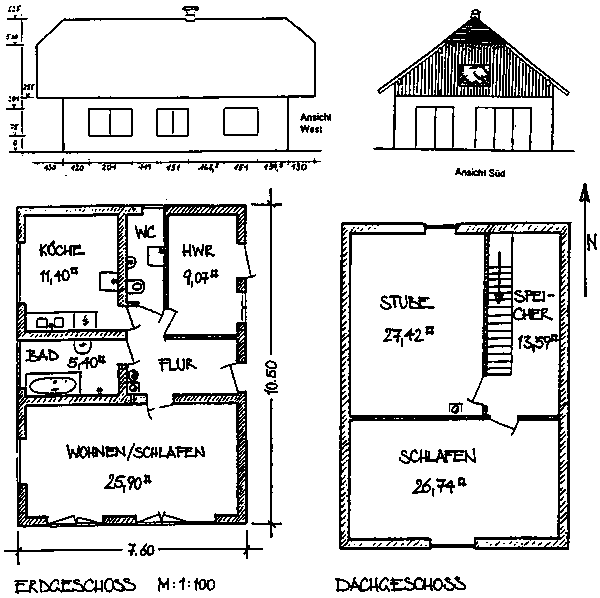Naturapostel und Geschäftemacher
»Les extrèmes so touchent«
(Die Extreme berühren sich) |
| Französische Redensart |
Ich bin ungerecht, aber mein Gefühl kann nicht anders: Ich weiß,
viele möchten anders, glauben sich aber durch alle möglichen
Umstände zum unguten Leben gezwungen. Viele wissen es nicht besser. Es
belustigt mich nun einmal und reizt mich zum Spott, wenn ich am Badestrand das
käsebleiche Büromännchen mit den Zahnstocherbeinchen und dem
Kürbisbauch seine eckigen Freiübungen machen sehe und wenn ich im
Wald dem Morgenläufer im grellen Streifentrikot mit Vereinsabzeichen und
Stollenschuhen begegne. Sie kommen mir wie Hampelmänner vor. Sicherlich es
es nicht schlecht, was sie tun, aber viel nützt es auch nicht. Wie wenn
der Raucher vor die Tür tritt und einmal tief Luft holt. Lauter Theater:
Radwandertag, Fitnessmärsche, Volkswandertage, fünf Minuten
Morgengymnastik, der wöchentliche Safttag. Dieselben Leute, die so tapfer
herumturnen, lassen sich mit dem Lift auf den Berg befördern, mobilisieren
ihr Auto für einen Weg von 500 Metern unter dem Vorwand, so wenig Zeit zu
haben und beschaffen sich im Büro einen Stuhl mit Rollen unter den
Füßen, damit sie vom Schreibtisch zu den Akten fahren können,
während oft die beste Tätigkeit für sie wäre, aufzustehen
und umherzugehen. Diese Gesundheitssportler und Safttagstanten machen eine Kur,
eine Behandlung. Falsch leben, aber ständig etwas daran reparieren.
Als ob man nicht gleich richtig leben könnte, von früh bis
spät natürlich und gesund. Stundenlange Spaziergänge,
Bergbesteigungen, leichte kurze Feldarbeiten, nie länger als eine Stunde
die gleiche, Müßiggang, Spiel und Unterhaltung, gemischte,
natürliche aber spärliche Kost, das bringt die ersehnte
Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und Gesundheit. Nicht das Gewaltsame,
Krampfhafte, Kurze und Eilige. Ich meditiere nicht, mache keine Yogasitzungen,
keine Morgengymnastik und keinen Dauerlauf, und die glücklichsten
Menschen, die Hirten und Höhlenbewohner, von denen schon die Rede war,
kämen sicher nicht auf solche Ideen. Ich lebe gelassen und natürlich:
Mit Sonnenaufgang oder mit Abbruch des Vogelkonzertes wache ich auf und bin
ausgeruht, oder ich schlafe ausnahmsweise noch ein Stündchen oder zwei.
Ich schlafe immer herrlich. Nach dem Aufstehen zieht es mich in den Garten. Ich
mache ein paar Schritte im taufeuchten Gras, atme die leichte Morgenluft ein
und sehe mir das Wetter an. Die Vögel zwitschern, alles ist friedlich. Ich
schreibe einen Sachbericht. Diese Schilderung dient nicht dazu, romantische
Sehnsüchte zu wecken. Aber die hier geschilderten
»Belanglosigkeiten« sind eine wichtige Voraussetzung für
Wohlbefinden und Gesundheit.
Nach der Dusche ein gemütliches Frühstück, ein wenig Arbeit
im Garten oder im Haus, ein ausgedehnter Spaziergang. Ich beobachte alles: Ein
Igel marschiert auf hohen Beinen unter den Haselbusch, eine Amsel schimpft,
weil die Katze herumschleicht, ein Riesenmohn ist aufgegangen und klatscht mit
seinem Rot in die grüne Wiese, die Schaufel an der Wand ist über
Nacht umgefallen.
Scharlatanerie oder schwärmerische Ahnungslosigkeit ist es, wenn einer
verkündet, wie man mit Knoblauch oder Brennesseln wahre Wunder der
Gesundheit vollbringen kann. So einfach geht das nicht! Aber eine bequeme
Heilslehre findet mehr Anhänger als eine unbequeme.
Es wird beschworen und abergeglaubt und schon geraten die Naturverfechter
und Industriefeinde in einen Topf mit Mystikern und Geschäftemachern. Der
biologische Landbau, der Gift vermeiden will - sonst nichts!
-, ist sehr zu befürworten. Aber sogleich wird er ausstaffiert
mit Zeitschriften von Vereinen, mit geheimnisvollen Wurzelkräften, mit
einem Magnetismus, über den Menschen, Tiere und Pflanzen miteinander in
Verbindung stehen sollen, mit magischen Lebensenergien im Boden und einem
Märchenmilieu, wonach die menschliche Phantasie anscheinend lechzt.
Gerade dieser Hokuspokus verhindert die Anerkennung des naturnahen Lebens.
Denn wer an nüchternes Denken gewöhnt ist und nur glaubt, was ihm
begreiflich gemacht oder bewiesen wurde oder was er selbst erlebt hat, kommt
leicht zu dem voreiligen Schluß, die Leute, die zurück zur Natur
wollen, seien alles abergläubische Schwärmer, keine Realisten.
Der Rationalismus wird gern angeklagt, Urheber des heutigen Unglücks zu
sein. Aber nicht die Aufklärung, die Vernunft, die Wahrheitssuche und die
Entmythologisierung der Welt haben uns das »technische und
kapitalistische Unheil« beschert, sondern der Mißbrauch der
Erkenntnis entweder zur verantwortungslosen Bereicherung oder in gutem Glauben
zu schlechten Zwecken. Wenn man weiß, wie Beton gemacht wird, muß
man noch lange keine Hochhäuser bauen. Wenn man die Atomspaltung kennt,
muß man noch lange keine Atombombe herstellen. Wenn man DDT hat,
muß man noch lange nicht damit die Welt vergiften. Man kann trotz aller
Wissenschaft und Kenntnis einfach und bescheiden leben, ohne sich zu bereichern
oder das Leben und die Welt entscheidend zu verändern. Man muß
lediglich wissen, daß das beste Leben das natürliche ist. Keineswegs
wäre es gerechtfertigt, als Reaktion auf den Rationalismus eine Spuk-,
Zauber-, Ritual- und Mythenwelt an die Stelle der aufgeklärten setzen zu
wollen. Denn die irrationalen Weltanschauungen waren und sind verderblich,
brachten Kriege, Menschenopfer und Hexenverbrennungen und vor allem
naturwidrige Lebensregeln mit sich.
Schließlich darf eine ganz gefährliche Menschengruppe nicht
unerwähnt bleiben. Das sind die Geschäftemacher. Kaum hat man die
Spritzmittel aus dem Garten verbannt, schon flattern einem Prospekte über
natürliche Spritzmittel ins Haus, sündhaft teuer und -
angeblich aus Pflanzenextrakten hergestellt. Den Komposthaufen sollen wir nicht
etwa den Regenwürmern überlassen. O nein, er soll mit einer
besonderen Mikrobenkultur geimpft werden und einen Bretterkäfig für
die Durchlüftung bekommen - womöglich aus Teak Holz und
dreimal imprägniert, der teurer ist als das Gemüse, das je auf diesem
Kompost wächst. Rascheste Kompostierung, maximale Erträge,
Spitzenqualitäten, genau das ist das Vokabular, von dem wir uns befreien
wollen. Manchmal habe ich den Eindruck, als ob es die gleichen Manager sind,
die uns Fortschritt, Industrie, Hektik und Umweltverschandelung beschert haben,
wie jene, die jetzt die »grüne Revolution« machen und
neuerlich daran verdienen.
Sparsamkeit und Lebenspraxis
Wer einem Menschen einmal helfen will,
der schenkt ihm einen Fisch.
Wer einem Menschen immer helfen will,
der lehrt ihn fischen. |
| Jüdisches Sprichwort |
Durch den Geldmangel in meiner Jugend war mir große Sparsamkeit immer
selbstverständlich. Seit ich verdient habe, stand auch schon mein Sparziel
fest: Ich will mich später »freikaufen«. So brauchte ich in
dieser Hinsicht keinen Gesinnungswandel. Bei den meisten jungen Leuten heute
wird es anders sein. Sie sind verwöhnt und glauben, dabei ein
glücklicheres Leben zu führen als in Genügsamkeit. Es wäre
Sarkasmus um des Effektes wegen, wenn ich behaupten wollte, wir leiden an zu
viel Geld. Das ist es nicht, aber wir leiden unter der Arbeit und den
Zwängen, dieses nicht sehr nötige Geld zu beschaffen.
Die Genügsamkeit fällt einem, zu Beginn vor allem, solange sie
noch nicht selbstverständliche Gewohnheit ist, leichter, wenn man sich bei
jeder Einsparung, bei jedem Konsumverzicht sagt, so und so viele Stunde brauche
ich jetzt weniger zu arbeiten, kann ich früher mein freies Landleben
beginnen. Im unverdorbenen Naturmenschen drosselt schon der Instinkt den
Arbeitseifer. Wir hingegen brauchen eine verstandesmäßige Hilfe, um
die anerzogenen Arbeitsverherrlichung abzubauen. Viel arbeiten, viel verdienen
und wieder ausgeben, ist nicht gescheiter, als Wasser in ein Faß ohne
Boden zu schütten. Dennoch huldigt ein Großteil der Bevölkerung
diesem Prinzip und kommt sich dabei klüger als die anderen vor. Den halte
ich für gescheiter, der wenig Geld verbraucht und dafür das Vorrecht
genießt, wenig arbeiten zu müssen. Man kann sich leicht im Verbrauch
von Zigaretten, Bier, Fleisch, teurer Fertigkost und Gefrierkost
einschränken. Man kann auch Waschpulver und Strom sparen, mäßig
heizen, Kleidung, Auto und Wohnung sowie Wohnungseinrichtung billig wählen
und so lange benützen, bis diese Dinge unreparabel aufgebraucht sind und
sie nicht schon erneuern, wenn Mode oder Werbung dazu verführen. Ein
Urlaub im Bayerischen Wald ist in mancher Hinsicht schöner als einer in
Tunesien, Rom oder Teneriffa. Man kann am Sparen Freude bekommen. Ich heize auf
19 Grad, ziehe einen warmen Pullover und ganz dicke Socken an, freue mich an
der Ersparnis - und bekomme nahezu nie Schnupfen oder Grippe. Dies
ist nicht die Freude des Geizkragens, der sich ja nur an der Anhäufung von
Vermögen freut, sondern ich verschönere mit Sparsamkeit das Leben:
Sparsamkeit erst schenkt uns Freiheit, Gesundheit, Geruhsamkeit und
Naturnähe. Ich betrachte Sparen als Sport.
Man kann Gurken in einer elektrischen Küchenmaschine hobeln. Man kann
sie aber auch mit dem Messer schneiden oder mit einem Brettchen mit
eingesetztem Messer, dem Gurkenhobel. Tut man letzteres nur in dem Gefühl,
eine Küchenmaschine ist mir zu teuer, so ist das schlecht. Man muß
sich sagen: Die Maschine lärmt, verbraucht Strom, zu dessen Erzeugung
Landschaft verschandelt wird und um sie zu bezahlen, müßte man 20
Stunden arbeiten und nach 6 bis 8 Jahren ist sie sowieso unbrauchbar. Darum ist
es besser, mit der Hand zu hobeln. Fährt man Rad, nur weil man sich kein
Auto leisten kann, so ist das schlecht. Sagt man sich aber, Radfahren ist
gesünder, leiser, hübscher in der Landschaft und erspart die
furchtbar viele Arbeit, die man für das Auto aufbringen müßte,
um es zu verdienen, dann fährt man viel freudiger Rad, dann spart man
lieber und leichter. Man kann den Rasen mit dem Rasenmäher oder mit der
Sense schneiden, Erbsen aus der Dose nehmen oder dämpfen. Immer wird die
sparsamere Arbeit eine ganze Reihe von Vorteilen haben, und derer sollte man
sich bewußt werden.
Das einfache Leben ist nicht nur durch Wareneinsparung gekennzeichnet,
sondern auch durch Arbeitseinsparung. Den Hausfrauen wurde nicht zuletzt
deshalb die Hausarbeit abstoßend, weil sie viel zu viel Unnötiges
gearbeitet haben. Man kommt mit halb so viel Geschirr und Besteck aus, Fenster
putzen, Staub wischen, Schuhe polieren, aufkehren, Gläser säubern,
Wäsche bügeln, Böden wischen... meinetwegen, aber viel, viel
seltener! Stattdessen spazieren oder baden gehen, mit Kindern spielen oder in
der Sonne liegen, Blumen pflücken, Pilze sammeln oder Freunde besuchen.
Dann macht der Haushalt wieder Freude.
Autarkie und Spezialistentum
| Wer einen Beruf ergreift, ist verloren. |
| H.D. Thoreau |
Jeder Berufstätige ist heute ein Spezialist und sehr abhängig von
Mitmenschen, die er kaum kennt. Das ist noch nicht lange so. Früher waren
die meisten, damals noch bäuerlichen Familien weitgehend autark.
Nahrungsmittel, Wolle, Textilien, Bauholz, Brennholz, Haus- und
Arbeitsgeräte wurden in überaus vielseitiger Beschäftigung auf
dem eigenen Hof hergestellt. »Noch bis spät ins 18. Jahrhundert
wurden 99% aller Nahrungsmittel der Welt in einem Umkreis erzeugt, den der
Verbraucher von seinem Kirchturm oder Minarett her überblicken
konnte« (I.Illich: Fortschrittsmythen).
Der Spezialist leistet mehr als der Universialist? Mehr leisten und
verdienen ist aber das Idol unserer Zeit, so daß die Nachteile des
Spezialistentums übersehen werden. Abgesehen von Gemüts- und
Körperschäden durch die Einseitigkeit der Arbeit, lebt der Spezialist
- und er mag noch so ein hohes Tier sein - in einer
unterschwelligen Angst, allen möglichen Leuten ausgeliefert zu sein. Nicht
nur den Vorgesetzten und Untergebenen, sondern auch noch dem Klempner und
Elektriker, dem Briefträger und dem Kaufmann, dem Finanzbeamten, Maurer,
Kunden und Öllieferanten, dem Automechaniker und dem Schneeräum- und
Müllabfuhrdienst. Sogar die Regierungsspitzen sind den Wählern und
der Industrie ausgeliefert und viel unfreier als ein kleiner Bauer vor 200
Jahren.
Der heutige Spezialist leidet gleichzeitig an Überheblichkeit und
Minderwertigkeitsgefühl. Sein Spezialkönnen überbewertet er und
hält jeden Laien dieses Faches für unfähig, auch nur eine Spur
von der Sache zu verstehen oder zu können. Umgekehrt hält man sich zu
allem unfähig, was man nicht studiert oder gründlich und jahrelang
gelernt hat. Ein 14 jähriger Schüler ist universeller und
lebenstüchtiger als die meisten Spezialisten auf der Höhe ihrer
Laufbahn. Die eingebildete Unfähigkeit führt dazu, daß man sich
von Spezialisten mißbrauchen und betrügen läßt. Es wird
einem vom Verkäufer etwas »aufgeschwätzt«, vom Beamten
etwas »vorgemacht« und vom Arzt etwas »weisgemacht«.
Ein halbwüchsiger Schüler traut sich ohne weiteres zu, rechnerich
abzuschätzen, ob man mit Heizöl oder Strom billiger heizt. Zur Not
schlägt er gewisse Daten nach. Der so intelligente Richter, Arzt oder
Musiker hingegen läßt sich von einem Vertreter oder einer
Werbebroschüre in einer bestimmten Angelegenheit wehrlos hinters Licht
führen. »Das sind ja Wärmetechniker, die werden's schon
wissen.« Ebenso, wenn der Wasserhahn tropft. Der moderne Spezialist
vertrottelt im gleichen Maß in berufsfremden Dingen, wie er sich in
seinem Fach vervollkommnet. Und wenn einer sein Wehwehchen selbst kurieren
will, dann wird ihm gar Verantwortungslosigkeit vorgeworfen, denn heilen kann
nur der Arzt.
Unsere Gesetzgebung ist gefährlich. Sie fördert
Allgemeingeschicklichkeit, Eigeninitiative, Vielseitigkeit, Erfahrenheit und
Wendigkeit nur in Einzelfällen, eher unterbindet sie diese sogar durch
Strafandrohung. Anlaß hierfür sind die gewerblichen Interessen, denn
wenn die Leute zu viel können und selber machen, verlieren die Profis ihre
Gewinne. So wird Universalität unter dem verlogenen Vorwand des
Sicherheitsbedürfnisses erschwert.
So wie jeder mit ein wenig Information und genügend Bemühung
kochen, Brot backen und seine Nahrung selber anbauen kann, so kann jeder fast
alles, was zum gesunden, behaglichen Leben nötig ist. Wer nichts kann,
kann beinahe schon alles. Der Spezialist versteht sich nur auf weniges.
Wer viel auf Handwerker angewiesen ist, muß viel zahlen. Wenn nur
irgend möglich, sollte man seine Möbel selber bauen, für das
Obst sorgen und Gemüse aus dem eigenen Garten ernten und vor allem
beschädigte Sachen instandsetzen. Ich repariere - mit unsicherem
Ausgang - auch schon mal ein Radio, Auto oder einen Trockenrasierer
und habe das alles nie gelernt. Was ich speziell für Schule und Beruf
systematisch gelernt habe, kann ich fast nicht brauchen. Trotzdem traue ich mir
zu, alles zu können, was ich brauche. Freilich kann ich nichts vollkommen.
Aber mir genügt meine Fertigkeit. Zum einigermaßen
unabhängigen, autarken Leben gehört auch die Bescheidenheit im
Anspruch. Selbstgemacht ist besser, auch wenn es kleine Mängel hat.
Außerdem sieht es persönlicher und natürlicher aus. Man hat
viel Abwechslung und spart eine Menge Geld. Das ganze Lebensgefühl ist
gehoben, wenn man sein Essen - von der Erde bis zum Tisch -
selbst macht und von Gegenständen aus eigener Hand umgeben ist. Im
bäuerlichen Bereich gibt es noch solche Universalgenies, aber sie werden
allmählich sehr selten werden, weil alle Arbeit dem Gewinndenken
untergeordnet wird.
Mein Landbau ohne Gift
Medizin ist ein Viertel,
gesunder Menschenverstand drei Viertel. |
| Indisch |
Ein paar Bücher über den Anbau von Blumen, Gemüse und Obst
waren der Anfang. Dann habe ich meine Wiese umpflügen lassen und mit
meiner kleinen Hackmaschine zerkrümelt. Schließlich habe ich
Kunstdünger gestreut, trotz aller Abneigung gegen chemische Produkte. Der
Boden war krank. Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte hatte man gemäht, das
Heu abgehobelt und keine Nährstoffe ersetzt, weder Stallmist noch Kompost
oder Kunstdünger gegeben. In unserer Abneigung gegen Unnatürliches
sollten wir sachlich bleiben und uns vor Vorurteilen und Gefühlsduselei
hüten. Trennen wir scharf solche Stoffe, die natürlicherweise im
Boden vorkommen oder diesen äußerst ähnlich sind und sich in
sie verwandeln von jenen, die nur ein Kunstprodukt des Menschen sind,
ihresgleichen in der Natur nicht haben und daher auf die
Stoffwechselvorgänge der Lebewesen nicht abgestimmt sind, also nur
lebensfeindliche Eigenschaften haben, was ja oft ihr Zweck ist.
Kalkstein ist fast in jedem Boden vorhanden und außerdem beinahe
für alle Pflanzen lebensnotwendig. Außerdem reguliert er den
Säuregrad des Bodens. Gemahlener Kalkstein ist Düngekalk, ein
»Kunst-«Dünger also, der reines Naturprodukt wie das ebenfalls
nützliche Gesteinsmehl ist und nicht aus der chemischen Fabrik stammt. Auf
eine saure Wiese - »sauer« ergibt die Bodenuntersuchung
- oder auf den Acker Düngekalk streuen, ist eine
lebensfördernde Maßnahme, die mit Vergiftung nichts zu tun hat. Kali
ist ebenfalls ein allgegenwärtiger Bodenbestandteil. Zu wenig davon ist
schlecht, zu viel auch. Gegen Kalimangel wäre Jauche am besten. Ich hatte
keine und habe schwefelsaures Kali gestreut. Das kann man immer noch als eine
leidlich natürliche Maßnahme ansehen. Es stammt aus Salzlagern im
Boden, die das Meer dort vor Jahrmillionen erzeugt hat. Eine solche Kalibeigabe
reicht für viele Jahre aus, weil sie kaum ausgewaschen wird, so daß
man von so einer ganz seltenen, etwas gewaltsamen
»Bodenfütterung« keine erhebliche Schädigung der
Bodenlebewesen befürchten muß. Genauso steht es mit
Phosphatdüngern. Etliche stammen aus natürlichen Minerallagern, von
denen einige durch Vogelexkremente zustandegekommen sind. Ein ähnliches
Produkt, aber künstlich erzeugt, ist das Thomasmehl, ein Abfallprodukt der
Stahlerzeugung. Derlei Kali- und Phosphatdünger sind keine naturwidrigen
Stoffe. Ein Großteil unserer Gesteine und Ackerböden, die
hauptsächlich zerkleinertes Gestein und Humus (=verwitterte Pflanzen- und
Tierreste) sind, bestehen daraus, nur mit dem Unterschied, daß der Boden
diese Stoffe in Verbindungen (meist mit Kieselsäure) enthält, die nur
spurenweise im Wasser löslich sind und deshalb den Pflanzen nur
beschränkt zur Verfügung stehen. Die Pflanzen, die ja nur
»trinken« können, lösen mit Saftausscheidungen ihrer
Wurzelhaare, ebenso wie Bakterien und andere Mikroben, sehr langsam die
mineralische Materie auf und ziehen sie so allmählich in den Stoffwechsel
der Lebewesen herein. Wenn wir nun Mineraldünger streuen, helfen wir etwas
nach, füttern die Pflanzen also mit dem, was sie sich sowieso aus dem
Boden holen, aber dort stellenweise viel zu wenig vorfinden. Im Prinzip ist der
Vorgang also nicht anders als wenn wir den Boden bewässern. Vorteile der
Naturdünger, von Jauche, Mist, Kompost und Gründüngung sind,
daß sie Humus bilden, vielerlei Nährstoffe, viel unterschiedlichere,
als die Mineraldünger enthalten, und reich an Mikroben, Würmern,
Insekten und anderen Lebewesen sind. Eine gewisse Vorsicht bei der Wahl von
Mineraldüngern ist angebracht. Immer sind die langsam wirkenden, schwer
löslichen schonender, gefahrloser und deshalb vorzuziehen, zumal sie auch
nicht so leicht vom Regen aus dem Boden und in unsere Gewässer gewaschen
werden und dadurch auch noch sparsamer sind. So ist zum Beispiel Thomasmehl dem
Superphosphat vorzuziehen, Düngekalk dem gelöschten oder gebrannten
Kalk. Überdüngung ist ebenso schädlich wie
Überfütterung bei Mensch und Tier. Deshalb gehe ich mit
Mineraldünger äußerst sparsam um. Selbst mit Jauche ist eine
Überdüngung (zu viel Kali) möglich, während man mit
Stallmist, Kompost oder Gründüngung so leicht nichts übertreiben
kann. Stallmist fehlt mir. Als guter Ersatz dient die Gründüngung.
Pflanzen, wie Lupinen, Ölrettich, Raps oder Klee, werden in ausgewachsenem
Zustand da, wo sie gewachsen sind, nach dem Mähen einfach liegen gelassen
oder eingehackt.
So wurde schließlich aus der gehaltlosen, sauren Wiese ein
überaus fruchtbarer Ackerboden, und ich habe mir zunächst einmal
für den Eigenbedarf Gemüse, Salat, Gewürze und Kartoffeln
angebaut und auf Blumen auch nicht verzichtet. Schließlich habe ich
Obstbäumchen gepflanzt, Beerensträucher und Erdbeeren. Jedes Jahr ist
es ein langes und freudiges Erlebnis, zu beobachten, wie die Pflanzen aufgehen,
sich entwickeln, blühen und fruchten. Jetzt im dreizehnten Jahr meines
Landbaues finde ich daran dieselbe Freude wie am Anfang. Aber der Bauer, der
mit großen Maschinen Monokulturen anlegt, betätigt sich mehr als
Maschinist und hat solche Freude längst eingebüßt.
Wer Neuling ist und erst sein Selbstvertrauen stärken will, sollte sich
im ersten Jahr mit den allergenügsamsten Gewächsen begnügen. Ich
schlage vor: Salat, Erbsen, Buschbohnen, Radieschen, Schnittlauch, Kartoffeln,
Gartenerdbeeren, Salatgurken, Sonnenblumen, Rudbeckia, Klatschmohn,
türkischer Riesenmohn, Ringelblume, Kapuzinerkresse und Rittersporn. Dabei
kann nicht viel mißlingen.
Leider wird es allen so gehen: Am tüchtigsten unter den Gewächsen
ist immer das Unkraut. Da hilft nichts als hacken oder ausrupfen. In neuerer
Spezialliteratur findet man auch Hinweise für bestimmte
Pflanzenkombinationen und Pflanzenfolgen, die den Unkrautwuchs eindämmen.
Chemisch totspritzen ist eine arge Sünde. Die Schonung des Bodens und des
Lebens muß einem ins Gefühl übergehen. Es muß einem
ebenso weh tun, mit Giften herumzuspritzen, wie sein Baby zu vergiften.
Freilich bleiben unliebsame Überraschungen nicht aus. Mir sind in 800
Metern Höhe am Anfang die Tomaten und Gurken im Oktober erfroren, die
Zwiebeln zu klein geblieben, der Schnittlauch verunkrautet und der Hasenbesuch
zu viel geworden. Im zweiten Jahr war der Kartoffelkäfer zu Besuch. Es war
eine Kleinigkeit, ihn auf der kleinen Fläche für eine Familie
abzusammeln. Es wäre den Versuch wert, ihn einmal ungestört gedeihen
zu lassen. Ob nicht die Natur ein Regulativ hervorbringen würde?
Übrigens ist er viele Jahre lang nicht wieder aufgetreten.
Möglicherweise haben sich seine Feinde eingefunden. Meine
Stachelbeerbüsche waren im dritten Jahr von kleinen, grünen Raupen
(Larven der Stachelbeerblattwespe) befallen, die alle Blätter abgefressen
haben und dann auf die roten Johannisbeeren übergesiedelt sind. Die Ernte
war hin, aber gespritzt habe ich trotzdem nicht. Ein paar Schubkarren Kompost
habe ich unter die Sträucher verteilt, zum Trost sozusagen. Und richtig,
die Natur hat sich selber geholfen: Es müssen sich die natürlichen
Feinde der Raupen eingefunden haben, ich weiß nicht, wie sie heißen
und muß es auch nicht wissen und erforschen. Jedenfalls hat sich das
vielzitierte »natürliche Gleichgewicht« wieder eingestellt,
und im nächsten Jahr gab es kaum noch Befall, im übernächsten
und auch weiterhin eine riesige Ernte. Mit den grünen und schwarzen
Blattläusen auf den Obstbäumen ist es mir ähnlich gegangen:
Ringelblätter, Kümmerwuchs, ein ganzer Pelz von Läusen,
Ameisenscharen. Im Jahr darauf waren die Marienkäfer mit ihren
gefräßigen Larven massenhaft zur Stelle. Über 50 habe ich auf
einem nicht einmal mannshohen Apfelbäumchen gezählt. Und seither gibt
es zwar noch Läuse, aber belanglos wenige, die meisten werden
aufgefressen. Es steht ja ein ganzes Heer gegen die Läuse bereit:
Schlupfwespen, Ohrenkriecher, Florfliege, Schwebefliege und vor allem
Marienkäfer. Ich glaube, es ist gut, daß die Läuse nicht
vollständig verschwinden, damit ihre Feinde nämlich nicht abwandern,
sondern ständig Wache halten. Hätte ich Chemikalien gespritzt,
wären nicht nur alle diese Wächter zugrunde gegangen, sondern auch
völlig unbeteiligte Lebewesen, Würmer, Käfer, Mikroben, von
denen der Boden voll ist und die für das Gedeihen der Pflanzen wichtig
sind. Außerdem würden die Gifte, deren Hauptmenge ja zu Boden
fällt, durch die Wurzeln ins Obst gelangen, zum Teil auch durch die
Blätter.
Als Nachteil muß ich in Kauf nehmen, daß mir beispielsweise in
Regenperioden 10 bis 20% der Erdbeeren verschimmeln, daß jede zwanzigste
Kirsche einen »Wurm« (Made der Kirschfruchtfliege) hat oder auf dem
Salat kleine Schnecken sitzen, die man erst abwaschen muß. Sind mir etwa
Krebs, Darm- und Leberleiden lieber? Die Stare und die Amseln holen sich auch
noch 10 bis 20% der Erdbeeren und Kirschen. Sollen sie's haben! Der Boden
ist gesund, und »meine« Vögel, von denen mehr als 10 Arten
meine zwei Hektar bevölkern, bekommen nur reine Insekten zu fressen. Die
Landwirtschaftskammer findet zwar eine giftfreie Landwirtschaft unsinnig und
meint vielleicht, ich hätte einen Vogel. Aber sie untertreibt, ich habe
hunderte. Und im Teich mitten in der Wiese geht es den Unken, Fröschen,
Fischen, Libellen und vielerlei anderem Getier prächtig.
Die Spritzmittel gegen Unkraut und Schädlinge sind nicht nur ein
Verbrechen gegen die Gesundheit, sondern im Laufe sehr vieler Jahre
läßt der Boden an Fruchtbarkeit nach und die Pflanzen bekommen
Krankheiten, weil der Humus schwindet und die Nützlinge vertrieben sind.
Die gestörte Harmonie zwischen Erde und Lebewelt stellt sich dann so
leicht nicht wieder ein. Bei ungünstigem Klima kann es sogar zur
Versteppung oder Erosion kommen, wie die Sahara, einst ein fruchtbares Land,
jetzt die größte Wüste, oder die Karstgebirge am Mittelmeer,
die einst dicht bewaldet waren, zeigen und wie wir es derzeit in Brasilien und
Mexiko erleben, wo kein Tag vergeht, an dem nicht große Ländereien
wegen Zerstörung des Bodens aufgegeben werden müssen. - Ja
dort... aber bei uns? Wir haben keine Ausweichmöglichkeiten. Wenn es
einmal bei uns so weit ist, dann ist es zu spät.
Das beste für Boden und Ertrag bleiben Mist und Kompost. Ich habe
keinen Mist und zu wenig Kompost. Also helfe ich mir mit der Wiese aus. Das
Gras, zu Haufen zusammengetragen, liefert schon nach einer Überwinterung
ausgezeichneten Kompost. Ein wenig mühsam zwar, aber die für die
Ernährung einer Familie erforderliche Fläche, die besonders intensiv
kultiviert werden muß, ist ja nur einige hundert Quadratmeter groß.
Bei meinen Erdbeeren, die ich verkaufe, ist das schon anders. Auf diesen 4000
qm liegen die Reihen 4 Meter auseinander. Das Gras oder das Lupinendickicht auf
den Grünstreifen dazwischen wird gemäht und an die Ränder der
Erdbeerreihen gerecht. Diese Abdeckung schützt die Erdbeeren vor Schmutz,
unterbindet den Unkrautwuchs und verwandelt sich übers Jahr in Kompost.
Meine ungespritzten, täglich frischen Erdbeeren finden restlosen Absatz zu
höchsten Preisen.
Die Landwirtschaft ringsum ist arm und reich zugleich: Reich an Maschinen,
manchmal auch an Gewinn, arm an Inhalt, Qualität, Gesundheit und
Schönheit. Liest dies einer meiner Nachbarn, empört wird er sich
gegen den »reichen« Gewinn wehren. Aber bitte: Pelzmantel, zweiter
Traktor, drei Autos, Geschirrspülmaschine, Farbfernseher, moderne Schuhe,
Schnaps, Bier und Zigaretten, kann man das etwa kaufen ohne reichlichen
Gewinn?
Wenn ich vor zwanzig Jahren an Kornfeldern vorüberging, leuchteten sie
voller Klatschmohn, Kornblumen und Kamillen. Heute sind sie blumenleer und
monoton - dank der Chemikalien. Wir brauchen nicht mehr Brot, wir
brauchen mehr Freude!
Meine Kleidung
Mach dir nie etwas daraus,
was die Leute sagen,
solange du in deinem Herzen weißt,
was du recht tust |
| Eleanor Roosevelt |
Fast haben es die Leute vergessen, was der Zweck der Kleidung ist: Schutz
vor der Witterung. Seit Kleidung zum Ziergegenstand, Prestigeobjekt und
Modeartikel umbewertet wurde, ist es mit deren Zweckmäßigkeit und
Sparsamkeit vorbei.
Es ist halt Geschmackssache und schaden tut es keinem: einen
abgestoßenen Hemdkragen, durchgewetzte Ellenbogenärmel, runzelige
Schuhe oder eine nicht blütenweiße oder schneeweiße, sondern
nur kalkweiße Wäsche zu tragen.
Ich trage meistens Anzüge, die Verwandte abgelegt haben, weil sie aus
der Mode gekommen sind. Meine Pullover sind geflickt und die Unterwäsche
darf ruhig Löcher haben. Ich trage oft eine dunkelgrüne
Strickmütze und Bergschuhe. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl,
daß mir aus dieser Kleidung ein Nachteil entsteht.
Die Perfektion einer gepflegten Bügelfalte, wie wäre es
übrigens, diese einmal rechts und links statt hinten und vorne zu tragen,
ihr Modeschöpfer, wäre da nicht ein Geschäft zu machen? Die
Perfektion einer Krawatte, eines Ziertaschentuches in der Brusttasche oder
eines »todschicken« Hutes, alles neu und teuer, die ist nichts als
dumme Mode, genährt vom Prestigedenken und von Geschäftemachern, aber
auch von der Diktatur »man muß...«. Je vollendeter und
eleganter die Kleidung, um so wohlhabender und gesellschaftlich
höherstehend, also tüchtiger und gescheiter der, der darin steckt.
»Kleider machen Leute,« nämlich angesehene.
Ansätze zur einfachen Kleidung gibt es in der Jeans-Mode und im
Safari-Look. Widersinnig wird diese vorgetäuschte Naturnähe
allerdings, wenn eine Hose mit von vornherein aufgesetztem Fleck und
künstlich ausgefransten Rändern den Preis eines teuren Modeartikels
hat. Man läßt sich das ärmliche Aussehen etwas kosten, ohne zu
bedenken, daß dieses nicht das Ziel, sondern die Folge einfachen Lebens
ist.
Am Hafen von Piräus lagert meist eine Menge junger Leute,
Ferienreisende, die das verstanden haben. Sie haben eine sehr einfache
Lebensweise und bequeme, zweckmäßige Kleidung, in der sie sich wohl
fühlen und die nicht viel kostet.
Die Kleidung auf dem Lande sollte nicht nur unempfindlich und dauerhaft
sein, sondern im Winter auch besonders warm. Es wäre nicht nur
verschwenderisch, sondern auch ungesund, bei dünner Bekleidung stark zu
heizen. Wer seine Kleidung selber näht und strickt, wird den Kaufleuten
und Snobs nicht gefallen. Aber das braucht man ja auch nicht. Und daß
dabei der Sexappeal zu kurz käme, braucht man nicht zu fürchten.
Denken wir nur an Sophia Loren, wenn sie eine Fischverkäuferin,
Schmugglerin oder Hure in einem Armenviertel darstellte. Auch wer nicht so
prächtig geraten ist wie sie, wird durch ungezwungene Natürlichkeit
in der einfachsten Kleidung anziehend wirken.
Ein Schuh, mit dem man nicht durch Wald und Wiesen und um die Wette laufen
kann, ist ein schlechter Schuh. Er gehört nicht aufs Land.
Meine Wohnung
| Ich besitze dieses schlecht konstruierte Fünfzig-Dollar-Haus im
Jersey-Sumpf. Sehr wenige Menschen besitzen ihr Heim in so hohem Maße wie
ich das meine. Meistens besitzt das Heim sie. |
| Prentice Mulford |

Natürliche Einfachheit im Haus von Gerhard
Schönauer
Der Wiener Psychiater Erwin Riegel hat als die wichtigsten
Wohnbedürfnisse des Menschen folgende herausgestellt: Geborgenheit,
Ungestörtheit, Kommunikationsmöglichkeit und Naturnähe. Er fand
außerdem, daß in hohen Häusern die Neurotisierung seiner
Patienten mit der Höhe des Wohnstockwerkes zunimmt.
Während meiner Studienjahre mußte ich zehnmal das Zimmer
wechseln. Neunmal fand ich es nicht zum Aushalten. Zuerst war der
Straßenlärm zu groß. Im zweiten Quartier wurde im Nebenzimmer
jeden Abend ein Mädchen verprügelt. Im dritten Quartier störte
sich die Vermieterin daran, daß ich im Gartenschuppen zwei Fahrräder
untergestellt hatte. Die vierte Wirtin war untröstlich darüber,
daß ich das Federbett geöffnet, fünf Naphthalinkugeln daraus
entfernt und die Naht wieder verschlossen hatte. Darauf war sie nur gekommen,
weil es unerhörterweise nicht mehr nach Mottenkugeln roch. Im
nächsten Stübchen dröhnte durch den Fußboden das Radio bis
Mitternacht. Dann gab es ein Quartier, in welchem immer meine Sachen untersucht
wurden, von der Unterhose bis zum Sparbuch. Und so flüchtete ich noch
einige Male. Die vorletzte Unterkunft fand ich in einem sehr »gebildeten
Haus«. Die höhere Tochter war dermaßen musikalisch, daß
mir nicht einmal Ohrenwatte half. Hinaus aus der Stadt! Endlich in Gerbrunn,
sechs Kilometer außerhalb der Stadt, wo kleine Häuser verstreut
stehen und die Hühner herumspazieren, wo sich hinter den Häusern auf
sandigen Hügeln große Kirschbaumpflanzungen ausdehnen, durch die ich
gerne einen Spaziergang machte, wenn mir der Kopf vom vielen Lernen brummte, da
fand ich schließlich meine Ruhe. Von meinen Spaziergängen brachte
ich oft Akazienblüten und Feldblumen mit nach Hause, die ich gelegentlich
meiner Freundin nach Würzburg mitnahm.
Geborgenheit, Ungestörtheit und Naturnähe hatte ich hier. An
Kommunikationsmöglichkeiten aber fehlte es, weil keine ähnlich
gesinnten Nachbarn hier wohnten. Und so wurde mir allmählich klar, wie man
am besten wohnen sollte: In einem kleinen Häuschen auf einem stillen Fleck
auf dem Lande, wo es Nachbarn gibt, mit denen man sich anfreunden kann, am
besten solche, die sich in ähnlicher Absicht angesiedelt haben.
Ich verzichte gern auf die Müllabfuhr. Meinen Abfall,
Küchenabfälle und Papier, mache ich zu Kompost. Plastik, Zeitungen
und Flaschen bringe ich von Zeit zu Zeit zum Recycling. Ich verzichte auf das
öffentliche Schneeräumen bis vor die Tür. Statt der Kanalisation
habe ich eine Senkgrube. Auf Strom habe ich zwar nicht verzichtet. Aber
wäre die Zuleitung zu teuer gewesen, so hätte ich mich mit
Flaschengas beholfen. Damit kann man auch Kühlgeräte betreiben.
Petroleumlampen sind sehr gemütlich. Gaslampen sind heller.
Von meiner Wohnung aus schaue ich auf Wiesen, Wald, Berge und meinen Garten,
statt auf Häuser und Straßen, Plakate und Autos. Meine Wohnung ist
wie ein Nest oder Fuchsbau: Natur in der Natur. Aber in der Stadt ist eine
Wohnung eine - wenn auch unzureichende - Verschanzung vor
der feindlichen Umwelt.
In der kümmerlichsten Hütte im Grünen würden die meisten
Menschen eher froh als in der luxuriösesten Wohnmaschine einer
Großstadt. Auf das meiste, was an einer Wohnungseinrichtung teuer ist,
kann man leicht verzichten. Einfache, selbstgezimmerte Möbel sind am
besten. Statt teurer Teppiche genügen Kokosfaserbeläge. Die
Türen brauchen keine Schlösser und Öffner. Ein knopfartiger
Holzgriff und Magnetverschluß ist schlichter und sparsamer. Lampenschirme
aus Draht mit Papier- oder Stoffbezug oder Weidengeflecht macht man sich
selber. Ist das Geld sehr knapp, so kann man sich auch mit einem Plumpsklo
begnügen.
Am wichtigsten ist mir noch das Bad. Eine Wasserleitung sollte man schon
haben. Wenn man sich dann einen Badeofen für Holz oder Flaschengas und
eine Badewanne aufstellt, so kostet das nicht viel . Und auf Kacheln,
Toilettentischchen und Solarium kann man gut verzichten. Für die
Handtücher genügen Nägel an der Wand. Was mir aber besonders
gefällt, ist der Ausblick von der Badewanne durch das Fenster auf Wald,
Berge und Wolken.
Die Wohnung soll mich nicht von der Natur ausschließen. Es geht ohne
Stufe ebenerdig ins Freie. Die Wohnung ist ein »erweiterter
Regenschirm«.
Der widersetzliche Staat
Wessen Regierung recht zurückhaltend, dessen Volk kommt recht
empor;
Wessen Regierung recht durchspähend, dessen Volk verfällt erst
recht. |
| Lao-Tse |
Der Souverän ist das Volk. Es setzt die Regierung ein. Die Regierung
hat den Wählerwillen zu erfüllen - sollte man glauben. Aber
das ist so lange her, daß es die meisten Regierungen vergessen haben. Die
meisten Völker werden gegen ihren eigenen Willen regiert. Der Staat ist
gegen die Rückkehr zum einfachen Landleben. Der Staat will Industrie,
Reichtum, Fortschritt, Konsum, Superbauten, Superstraßen und
Supermänner (viele Untertanen wollen das auch, weil der Staat ihnen das
eingeredet hat). Also gibt es Städte, Machtkonzentration und
Geschlossenheit der Siedlungen. Schon deshalb, weil die Machthaber selber alles
eher als bescheidene Selbstversorger, sondern Großverdiener und
Fortschrittswahnsinnige sind. Sie wollen die Welt nach ihrem eigenen Bild
gestalten - und so sieht sie auch aus.
Wir, die wir eine andere Welt wollen, haben es daher nicht leicht. Vor allem
macht man uns bei der Grundbeschaffung und Baubewilligung Schwierigkeiten. Aber
je mehr wir sind, je größer der Zug zum Land, zur Genügsamkeit,
zur Freiheit, zur Selbstbestimmung und Selbstversorgung, um so eher wird man
sich an der Spitze der Staaten der besseren Einsicht beugen müssen. Aber
bis es so weit ist, hat jeder einzelne nur dann Aussicht, seine
Lebensvorstellungen zu verwirklichen, wenn er bis zur Erteilung der
Baubewilligung sehr hartnäckig ist.
Solange die Baubehörden gräßliche, krankmachende
Betonhochhäuser, also Selbstmördertürme, bewilligen und
fördern, aber nette, landschaftsgemäße, unaufdringliche, kleine
Häuschen auf der Wiese und am Waldesrand verbietet, solange hat unsere
Obrigkeit noch nichts begriffen. Das schließt jedoch nicht aus, daß
sie einmal begreifen wird, weil sie muß. Auf die Dauer kann sich ein
System, und sei es noch so selbstherrlich, den wichtigsten Bedürfnissen
des Volkes nicht widersetzen.
Selber machen
| Den Menschen, der seine Lust im Gebrauch des konvivalen Werkzeugs findet,
den nenne ich nüchtern und zurückhaltend. Er kennt das, was im
Spanischen la conviviencia heißt, er nimmt Anteil am Mitmenschen.
Denn die nüchterne Zurückhaltung hat nichts mit Isolation,
Rückzug auf sich selbst, oder gar Fantasielosigkeit zu tun. |
| Ivan Illich |

Das selbstgebaute Eigenheim des Verfassers
Das Schiller-Zitat von der Axt im Haus wage ich nicht zu nennen, denn wenn
eine Wahrheit gar zu selbstverständlich ist und in aller Munde
geführt wird, wirft man ihr vor, sie sei banal.
In den letzten 10 bis 20 Jahren hat sich der Ruf des Do-it-yourself
wesentlich gebessert, während es früher eine lieber verschwiegene
Notwendigkeit der armen Leute war.
Inzwischen sind handwerkliche Tätigkeiten gegenüber der
zermürbenden Routinearbeit in Büro und Fabrik beliebter geworden und
genießen ein romantisch geadeltes Ansehen. Außerdem kommt der
natürliche Spiel- und manuelle Schaffensdrang bei den Leuten hervor, die
den Tag lang herumsitzen oder -fahren, so daß es für die
Geschäftsleute nicht mehr schwer war, hier eine einträgliche Branche
aufzuziehen, die es zuvor noch nie gegeben hat.
Für die meisten Bastler ist das Heimwerken allerdings zuweilen eine
teure Spielerei. Selber gemacht kann teurer sein als fertig gekauft. Auch ein
selbstgestrickter Pullover kann teurer sein als ein fertig gekaufter, wenn man
die Wolle kaufen muß. Säuberlich ausgesuchte, geschliffene Bretter
sind teuer. Fangen wir lieber auf primitiver Stufe an. Rohe Bretter aus dem
Sägewerk, Schrauben, Nägel und Leim, das ist genug, um eine ganze
Wohnung einzurichten.
Das Basteln und Handwerken wird dann zur großen Ersparnis, wenn wir
sehr konsequent alles, was uns möglich erscheint, selber machen. Als
Landbewohner haben wir im Winter lange dazu Zeit. Auch ist es sehr reizvoll,
wenn sich die Wohnung erst nach und nach organisch wachsend füllt, reich
an persönlichen Merkmalen. Bastelbücher als Anleitung gibt es so
viele wie Kochbücher. Man hüte sich aber vor Perfektion. Anleitungen,
wie man seine Kleidung selber macht, gibt es auch in jeder Buchhandlung. Ebenso
Gartenbücher für den Landbau. Sehr vielseitig, allerdings nur
unterschiedlich gründlich, ist Das große Buch vom Leben auf
dem Lande von John Seymour. Es bietet einen anregenden Überblick
über das, was es so alles gibt an Arbeiten auf dem Lande, wichtige und
auch sehr unwichtige. Aber es reicht keinesfalls als Arbeitsanleitung aus. Vor
allem für den Hausbau und die Installation braucht man genauere
Vorschriften oder erfahrene Freunde.
Wer meinen Bericht immer noch nicht weggelegt hat, gehört wohl zu den
Menschen, die mehr Freude daran haben, an langen Wintertagen Kleider, Hosen,
Hemden, Teppiche und Pullover zu fertigen, Wandregale, Tische, Lampenschirme,
Bänke und Betten zu bauen, ihre Schuhe zu besohlen und Sitzpolster zu
nähen, als Fernsehkrimis und Sportberichte zu »beglotzen«. Wer
seine Sachen gern selber macht und darin nicht nur ein notwendiges Übel
sieht, wird sich leicht damit abfinden, daß nicht alles so exakt wie aus
der Fabrik aussieht. Dafür hat man es in der Hand, alles sehr robust
herzustellen. Die Nähte halten länger, die Verbindungen wackeln
nicht. Ich habe Jahrzehnte in knarrenden Betten geschlafen; erst mein
selbstgebautes ist nun schon seit elf Jahren mäuschenstill und dabei ganz
einfach: Die vier Seitenteile aus zweischichtig verleimten Lärchenbrettern
sind an den vier Ecken über 6 x 6 cm Kanthölzer, die gleichzeitig die
Bettfüße sind, miteinander verschraubt, und zwar mit großen
Schrauben mit Muttern, so daß die Verbindungen sehr stramm angezogen
werden können. Als Betteinsatz dienen rohe Bretter, die auf an die
Seitenteile geleimten Latten aufliegen und mit Packpapier abgedeckt sind. So
einfach ist das beste Bett, in dem ich je geschlafen habe. Es kostet 4
Quadratmeter rohe Bretter, 8 Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben und ein
bis zwei Tage Arbeit, je nach Feinheit und Ausführung. Haltbarkeit:
Garantiert 100 Jahre, ohne zu knarren oder zu wackeln.
Wenn ich aber anfinge, meine Arbeitszeit mit Geld gleichzusetzen dann
sähe die ganze Sache unwirtschaftlich aus: 15 Stunden, das wäre ohne
Matratze ein zu teures Bett. Doch weil ich die fünfzehn Stunden frei und
auf dem Lande habe werken können, statt sie in einer Stadt in
abhängiger, vielleicht in eiliger oder angespannter und nervös
machender Tätigkeit mit allerhand Spesen und Nebenlasten, wie Fahrerei, zu
verbringen, ist es ein ideeller Vorteil, der mit Geld nicht zu bewerten ist.
Selber machen macht frei. Es zählt auch, daß man viel, viel dabei
lernt.
Grenzen der Autarkie
| »Small is beautiful« |
| E.F. Schumacher |
Ich wollte Hunderte Quadratmeter Bretter für Fußböden,
Türen und Möbel selber hobeln. Mit dem Handhobel dauert das viele
hundert Stunden. Eine Hobelmaschine ist teuer, gefährlich und unheimlich
laut. Schließlich habe ich vorgezogen, die Bretter beim Tischler
maschinell hobeln zu lassen.
In alten Zeit hat man ein halbes Leben lang an einem Haus gebaut. Heute ist
der Mensch entwurzelt. Wir fühlen uns in der Stadt fremd und heimatlos und
sehnen uns nach einem »Nest«. Deshalb dauern uns viele Arbeiten zu
lang, weshalb wir uns nicht darauf versteifen sollten, grundsätzlich alles
selbst machen zu wollen. Natürlich hätte es seine Robinson-Romantik,
wenn man Rinderhaut gerbt und sich daraus urwüchsige Schuhe näht,
wenn man seine Dachschindeln selber spaltet und das Getreide mit der
Handmühle mahlt. Dann aber haben wir täglich zwölf Stunden
Arbeit. Am Anfang ist das sehr spannend und befriedigend. Aber bald macht sich
der instinktive, angeborene Arbeitswiderwille breit, wie ich ihn im Kapitel
»Wenn Arbeit Laster wird« schildern werde. Wollen wir fürs
erste nicht in die völlige Primitivität zurück, weil uns ein so
großer Schritt schwer fällt, dann wird es am besten sein, auch bei
der Arbeit und der Autarkie einen Kompromiß zu schließen und in den
Bereichen, wo der eigene Aufwand ein übermäßig großer
wäre, uns der Spezialisten und der Industrieproduktion zu bedienen.
Ich säge Bäume ab, ich entaste und entrinde sie, aber ich schneide
keine Bretter daraus. Das überlasse ich dem Sägewerk. Ich besohle mir
meine Schuhe selber. Das lohnt sich, bedarf nur billiger Werkzeuge und freut
mich. Und wenn bei meinen Bergschuhen eine Naht aufgeht, so habe ich als die
einfachste und haltbarste Reparatur herausgefunden, sie mit kleinen
Sattlernieten wieder instandzusetzen. Trotzdem gehe ich nicht so weit, mir
Schuhe von Grund auf selber zu machen, was bei Kleidern recht leicht,
wirtschaftlich und unterhaltsam wäre.
Draht, Fensterglas, Nägel und Schrauben, die meisten Werkzeuge und ein
Auto oder Fahrrad kann man sich beim besten Willen nicht selber machen.
Blumentöpfe hingegen könnte man sich selber formen und brennen, doch
sind sie so billig, daß ich mir die Arbeit lieber spare.
Wenn ich unschlüssig bin, ob ich eine Sache selbst machen oder kaufen
soll, dann überschlage ich, wieviel Zeit sie mich kosten würde und
was ich dafür bezahlen müßte. So brauchte ich zum Beispiel
für meine beiden Treppen vier dicke Balken von fünf Metern
Länge. Damit es keine Verdrehungen und Risse gibt, sollten die Balken aus
sechs Bretterlagen verleimt hergestellt werden. Jeder Balken bekam für
jede Stufe einen tiefen Dreieickseinschnitt. Ich habe die Balken selber gemacht
und für jeden Balken eine Woche, also etwa 50 Stunden gebraucht. Damit
habe ich etwa DM 25,- in jeder Arbeitsstunde eingespart.
Wenn ich mir Brot backe, fünf Kilo in einem, so kostet mich das zwei
Stunden Arbeit. An einem Kilo spare ich etwa 1 DM. Früher habe ich
gebacken, aber da ich sehr wenig Brot esse, bin ich davon abgekommen.
Solange man unsicher ist, was man kaufen und was man selber machen soll,
kann man bei jeder Aufgabe prüfen, wie lange es dauern würde, wenn
man sie selber bewältigt. Man legt nach den persönlichen
Verhältnissen einen Betrag fest, den die Arbeitsstunde wert ist, zieht
vielleicht noch in Erwägung, wie angenehm oder unangenehm die betreffende
Arbeit ist und fällt danach die Entscheidung. Diese Haltung ist keineswegs
naturnah und angenehm und soll auch nur ein Übergang vor allem in der
Hausbau- und Aufbauzeit sein. Ist schließlich alles eingefahren und kann
man sich - von einigen Reparaturen abgesehen - endlich
darauf beschränken, nur das herzustellen, was man laufend verbraucht, dann
kann man getrost die Rechnerei wieder vergessen und wird sich an ein gewisses
Gleichmaß von einigen Verrichtungen und ein wenig Einkauf gewöhnen.
Wer alles selber machen will, wie etwa Bier brauen, Brot backen, Käse
zubereiten, Töpfern, Spinnen, Weben, Fässer bauen, Sauerkraut
einlegen, Methangas aus Viehmist herstellen, Öl pressen, Honig, Leder,
Seife und Ziegelsteine gewinnen, der hat zwar die Beruhigung, auch die
schlimmsten Krisen überstehen zu können, ohne Mangel zu leiden, doch
wird er bald die Lust an der zu umfangreichen Arbeit verlieren.
Im Zweifelsfalle würde ich die Genügsamkeit, den Verzicht
vorziehen. Könnte ich mir kein Bier kaufen, würde ich lieber Wasser
trinken, statt selber Bier zu brauen. Kommt darauf an, wie fleißig man
ist. Ich bin jedenfalls eher faul, aber ich bin es gern.
Der grüne Perfektionismus
| Über das Ziel hinausschießen ist ebenso schlimm wie nicht ans
Ziel kommen. |
| Konfuzius |
In vielen Köpfen spukt der Wunschtraum einer »Alternative«
nach Art des Schlaraffenlandes, die uns Komfort und Konsum ebenso beschert wie
die moderne Technik, nur eben mit vermeintlich gesunden, umweltfreundlichen
Mitteln. Diese Leute wollen keine Umkehr zur Natur und Einfachheit, sondern sie
wollen Fortschritt und Technik, nur eben in ihrer Geschmacksrichtung, das
heißt ohne Schädigung der Natur. Sie wollen Üppigkeit nach
neuen Methoden. Auch sie sind Wissenschaftler, Techniker und Manager, nur eben
grün verkleidet. Ich halte diese Richtung für besser als die
umweltfeindliche der heutigen Mächte, aber dennoch für verfehlt.
Es tut uns nämlich gut, Brennholz zu sammeln und zu hacken. Es tut uns
auch gut, schwach zu heizen und uns im Winter sehr warm anzuziehen. Es tut uns
auch gut, Schnee zu schaufeln und nur wenig zu essen, gesundes Wasser oder
Säfte statt Bier zu trinken und nicht zu rauchen. Das Schlaraffenland
macht krank. Selbst wenn es uns gelänge, durch eine glänzende,
umweltfreundliche Erfindung unser Heim sehr billig und mühelos auf 25 Grad
zu beheizen, so wäre es gefährlich. Wir würden unter
Bewegungsmangel und Erkältungen leiden. Eine breitere Untersuchung
über Erkrankungen auf Überseeschiffen hat ergeben, daß die
Erkältungen auf klimatisierten Schiffen etwa doppelt so häufig
auftreten wie auf nicht-klimatisierten. 1978 hat der Kommandant eines
Winterlagers des österreichischen Bundesheeres in Zelten den
Gesundheitszustand seiner Truppe als erheblich besser als in den Kasernen
bezeichnet. Wenn die Techniker es zustände brächten, uns
veilchenduftende, lautlose und sehr billige, aber dennoch schnelle Elektroautos
zu bescheren, dann wären wir vielleicht nicht besser dran als jetzt: denn
dann ginge vielleicht überhaupt kein Mensch mehr zu Fuß.
Mich kümmern nicht die sündhaft teuren Wärmepumpen für
den Kleinverbraucher, die winterlahmen Sonnenkollektoren, häßlichen
Windräder, wie wir sie in jeder Ecke unseres Gartens aufstellen und die
schwimmenden Wasserräder mit Kleinstkraftwerken, die in jeden Bach
gehängt werden sollen, nur damit unser aufgeblasener Komfort weiter ins
Kraut schießen kann. Sondern mir sind lieber das Wollzeug der
Großeltern und wärmende Pluderhosen, auch wenn das weniger
»sexappealing« ist. Pflanzen wir doch einen Waldstreifen an den
Nordrand unseres Grundstückes, sofern es groß genug ist. Holz ist
ein vorzüglicher Brennstoff und wächst von selbst nach.
Sparen wir mit Strom, dann brauchen wir nicht die herrlichen Alpentäler
mit Straßen und Kraftwerken zu verschandeln. Schlagen wir die Eier ruhig
mit dem Schneebesen und hobeln wir die Gurken mit der Hand. Was brauche ich
eine Kaffeemaschine, wenn ich den Kaffee einfach durch ein Teesieb gießen
kann? Ich habe kein Telefon, schreibe dafür aber oft Briefe. Wenn etwas
eilig ist, dann gehe ich eben zur Fernsprechzelle. Wenn wir viel Fahrrad fahren
und zu Fuß gehen, können wir das Auto immer noch für
große Fahrten verwenden.
Ist es nicht grüner Perfektionismus, wenn ein Kleinbetrieb aus seinem
Stallmist Methangas herstellen soll? Ist als Drahtzieher nicht doch wieder die
Industrie im Hintergrund am Werk, die uns Anlagen aufstellen will, die sich nie
amortisieren und deren Herstellung mehr Energie verschlingt, als mit dem
Apparat je zu gewinnen ist? Eine Kuh liefert auf diese Weise im Jahr 70
Kubikmeter Methangas mit dem gleichen Heizwert wie 120 Kilo trockenes
Brennholz, aber nur, wenn ihr ganzer Mist eingesetzt wird. Trägt man die
Kuhfladen nicht von der Wiese nach Hause, erhält man entsprechend weniger.
Lieber würde ich einmal im Jahr 120 Kilo Brennholz kaufen oder umsonst im
Wald sammeln oder auf dem eigenen Gelände wachsen lassen und schlagen, als
mehrere Bottiche mit Rührwerk und Rohrverbindungen, mit Ventilen,
Isolierungen und Sicherheitsvorkehrungen gegen Explosion aufzubauen, die nach
wenigen Jahren womöglich durchgerostet sind und täglich betreut
werden müssen. Wem die technisch-chemische Spielerei Spaß macht und
wer die 500 DM oder mehr dafür investieren will - wobei man
allein schon von den Zinsen des Einsatzes doppelt soviel Brennstoff kaufen
kann, als der Apparat produziert - bitte. Aber zum glücklichen Landleben
brauche ich so ein Gaswerk nicht.
Einfacher und billiger
| Der Genügsame ist reich |
| Lao-Tse |
Damit ich mich wohl fühle, brauche ich nicht mehr Kraftwerke,
Straßen und Güter. Ich schalte die Kochplatte schon 5 Minuten vor
dem Fertiggaren aus. Meinen Kühlschrank und meine Gefriertruhe habe ich in
Isolierplatten aus Porozell eingepackt. So dringt weniger Wärme in die
Kühlgeräte, die Kühlaggregate brauchen nur seltener zu arbeiten,
verbrauchen weniger Strom und halten länger. Ich brauche weder
ständig neue Kleidung noch neue Schuhe. Mir gefallen auch noch getragene
Sachen.
Der Geldmangel ist für die meisten Leute wahrscheinlich das große
Hemmnis (oder für andere nach der Prestigeeinbuße das
zweitgrößte), aufs Land zu ziehen. Immer wieder höre ich die
Städter vom Landleben, das sie vom Urlaub her kennen, schwärmen, aber
betrübt resignieren: Da kann ich ja fast nichts verdienen. Doch bin ich
überzeugt, wenn jeder Städter zum achtzehnten Geburtstag von der
Öffentlichkeit einen halben Hektar Ackerland und ein Häuschen
geschenkt und eine Rente von 1000 DM im Monat bekäme, dann wären die
Städte innerhalb einer Generation zu wenigstens drei Vierteln
entvölkert. Da es zwar Land, nicht aber diese Rente gibt, bleibt kein
anderer Ersatz für uns übrig als ein wenig Arbeit, nämlich
gerade genug für die Selbstversorgung, und ein wenig Arbeit für den
Zuerwerb. Den meisten unserer Großeltern und Urgroßeltern waren
Genügsamkeit und Sparsamkeit selbstverständlich, weil man damals im
allgemeinen trotz aller Mühe nur so wenig verdienen konnte, daß man
für ein großzügigeres Leben, wie es heute Brauch ist, kein Geld
hatte. Heute sind wir verwöhnt. In den Acht Todsünden der
zivilisierten Menschheit von Konrad Lorenz heißt es zutreffend:
»Die bescheidenste Hausgehilfin würde sofort empört
revoltieren, böte man ihr ein Zimmer mit Heizung, der Beleuchtung sowie
der Schlaf- und Waschgelegenheiten an, die der Geheimrat von Goethe oder selbst
der Herzogin Anna Amalie von Weimar durchaus ausreichend erschienen.«
Nun haben wir sie: Bequemlichkeit, Luxus und gute
Verdienstmöglichkeiten. Aber für welches Opfer! In Büros und
Fabriken, Labors und auf den Straßen, in Gehetztheit, Sklaverei und
Angst. Jeder hat die Wahl: Diese Arbeit - und andere gibt es nur
höchst selten - und diesen Lohn, oder Freiheit und keine
Bezahlung. Doch auch wer das letztere wählt, kommt an einigen harten
Aufbaujahren nicht vorbei. Wer nun die Freiheit vorzieht, kommt nur mit
großer Sparsamkeit zurecht. Alle möglichen Versuchungen machen sie
uns schwer. Zentralheizung, Berglift, Auto, Rollenstühle, Waschmaschine,
Staubsauger, automatische Küchengeräte und hunderterlei Maschinen
für die Warenproduktion und Landwirtschaft, eine Riesenauswahl zum Essen,
zum Kleiden, für Sport, Wohnung und Unterhaltung. Sie verführen uns
alle, sich ihrer viel zu bedienen. Das hat vor allem zwei schreckliche Folgen:
Erstens verhindert das die Sparsamkeit, so daß wir uns in die ewige
Abhängigkeit vom Geldverdienen begeben, und zweitens werden Wohlbefinden
und Gesundheit durch den Überverbrauch geschädigt.
Verschwendung soll Spaß machen? Ich finde, Sparen macht Spaß.
Ich brauche keine Papiertaschentücher. Aus zerrissenen Hemden und
Betttüchern schneide ich mir Taschentücher und säume sie ein.
Ich habe seit 20 Jahren eine Nähmaschine, mit der ich schon zwei Zelte
genäht habe und drei Rucksäcke. Auch viele Flick- und
Änderungsarbeiten sind mir damit gelungen.
Ich spare mit Vergnügen: Mit 14 Jahren erhielt ich eine Taschenuhr zum
Geschenk. Bis dahin hatte ich keine Uhr. Sie wurde zweimal repariert. Bis heute
habe ich keinen Anlaß gehabt, mir eine neue Uhr zu kaufen. Eine Uhr ist
für mich kein Zier- oder Modegegenstand und kein Wohlstands-, sondern
lediglich ein Zeitanzeiger.
Überflüssiges zu vermeiden, das freut mich. Ob es sich dabei um
Sachen oder um Arbeiten handelt, es ist dasselbe. Ich betrachte es als
Sport.
Es kommt vor, daß ich Staub sauge. Die vollen Papierbeutel, die 1,30
DM kosten, werfe ich nicht weg, sondern sammle sie, bis ich eine Schachtel voll
beisammen habe. Dann schüttle ich sie - am besten in der
Badehose - im Garten auf den Kompost und habe mir zum Beispiel in 10
Minuten 13 DM erspart.
Mit Recht ärgern wir uns über die Verschwendung, die mit
öffentlichen Geldern getrieben wird, über Dienstautos und
Repräsentationsaufwendungen, über luxuriöse Gemeindeämter
und Bankfilialen, über Verwaltungspaläste und Skulpturen, die unsere
Plätze und Autobahnen verschönern sollen, über kostspielig
gedruckte, großformatige Briefmarken, über öffentliche
Beleuchtung für drei Häuser. Mit Recht beklagen wir uns über die
Verschwendung, mit der statistische Ämter ein Heer von Angestellten
beschäftigen, um die Bevölkerung mit Fragebögen zu
belästigen und Archive mit Erhebungen über Zimmerpflanzen, exotische
Haustiere und Schlafgewohnheiten vollzupacken. Wohlgemerkt: vollklimatisierte
Archive mit einbrennlackierten Stahlschränken und Rollenschubladen,
Sicherheitsschlössern und angeschlossenem Computer nebst Feuerwarnanlage
und Sprenklern. Sicher beklagen wir all das mit Recht. Mag sein, daß wir
die Verschwendung auf politischem Wege, wenn es wider Erwarten einmal eine gute
Partei geben sollte, bremsen können. Doch das kann lange dauern. Bei uns
selbst können wir aber heute anfangen.
Ich brauche 2 Seifen im Jahr und nur wenige Tuben Zahnpasta, die billigste.
Ich habe noch nicht beobachten können, daß die teuerste besser wirkt
als die billigste. Mag sein, daß es genauso gut für die Zähne
ist, sie nur mit Wasser zu putzen, ich weiß es nicht. Eine elektrische
Zahnbürste habe ich jedenfalls ein halbes Jahr lang benutzt, bis ich
festgestellt habe, daß sie nichts taugt: Ich habe nämlich ein
gleichmäßiges, glattes Brettchen mit Heidelbeeren eingerieben und
sodann die eine Hälfte eine Minute lang mit der elektrischen
Zahnbürste, die andere mit der Handbürste und leichtem
Beträufeln mit Wasser gebürstet. Die handgebürstete Fläche
war deutlich heller als die elektrogebürstete.
Die meisten Leute entfetten ihre Haut zu sehr durch Seife. Solche Haut wird
leicht allergisch, wird bakteriendurchlässig und man holt sich
Krankheiten. Warmwasser reinigt normalerweise gut genug.
Zum Glätten meiner selbstgebauten Möbel habe ich viel
Schleifpapier gebraucht. Und zwar kreisrunde Schleifblätter, die auf einer
Gummiplatte befestigt werden, die mit einer Bohrmaschine angetrieben wird.
Eines Tages habe ich mir ein Schleifband, wie es für Tischlereimaschinen
verwendet wird, gekauft und daraus die Kreisscheiben geschnitten. Eine Scheibe
eine Minute. Jetzt sind die Scheiben nicht nur viel billiger, sondern halten
mehr als doppelt so lange.
Wozu soll ich Geschirr und Besteck abtrocknen, wo es doch von selber
trocknet? Wozu soll ich mein Auto waschen, wo das doch der nächste
Guß vom Himmel besorgt oder wenn es beim nächsten kleinen
Dreckwetter sowieso wieder schmutzig wird?
Wenn meine Schuhe wasserabstoßend werden sollen, so erfüllt die
billigste Paraffinpaste diesen Zweck genauso gut wie das teuerste Spray.
Was brauche ich für die Winterfütterung der Vögel teure Ringe
und komplizierte Sämereimischungen zu kaufen? Ein Kilo Sonnenblumenkerne
und ein Würfel Schmalz oder Margarine kosten 2 bis 3 DM. Das kriegen die
Kleiber, Meisen und Finken unvermischt serviert und sollen sich gefälligst
ihr Menü selbst zusammenstellen.
Teure Anschaffungen wären mir zuwider: Bücher etwa, die ich nicht
lese, kostbarer Schmuck, eine Filmkamera, ein Farbfernseher oder eine
Stereoanlage. Allein der Gedanke täte mir schon weh, daß ich
für so ein Objekt von sagen wir 3000 DM Wert 300 Stunden unerfreuliche
Arbeit verrichten sollte - das sind mindestens zwei Monate, die ich
nach Herzenslust schöner verbringen könnte: zu Hause oder im Garten,
auf Besuch bei Freunden oder auf Reisen in den Dolomiten, auf den Dalmatischen
Inseln oder auf Korsika, was ganz billig wäre und nur das Kilometergeld
kostet, wenn ich mich selbst verpflege und im Auto schlafe.
Es läßt sich kaum ein Gebiet im Haushalt und am Essen finden, wo
man nichts vereinfachen und einsparen könnte. Besonders wichtig ist das in
der Aufbauzeit, wo man sein Startkapital zusammenspart. Ich habe in diesen
Jahren fast nie Wein oder Bier getrunken, sondern mich mit Tee oder Wasser
begnügt. Ich habe kaum Kleidung gekauft.
Ach, ihr Armen, wie gut geht es doch mir! Ob meine Nudeln oder Kartoffeln
vorher oder nachher gesalzen werden, ein wenig zu hart geraten oder zerkocht
sind, ob das Fleisch saftiger oder trockener ausfällt, der Kaffee heller
oder dunkler, der Wein kühler oder wärmer ist, das ist mir zwar nicht
völlig gleichgültig, aber wichtig ist es mir auch nicht, denn ich
habe ja noch eine Menge andere Dinge, die mir Freude machen und die mein Leben
ausfüllen. Wer Essen und Trinken überkultiviert und
überbewertet, zeigt damit nur, daß er damit den Mangel an sonstigen
Freuden auszugleichen sucht.
Eine meiner erfreulichsten Mahlzeiten, die ich nie vergessen werde, hat auf
einer Wiese nahe dem Ufer der Drau stattgefunden. Dort war ich abends
angekommen, hatte mit meiner Freundin das Zelt aufgeschlagen und ein
Spiritusfeuer gemacht. Während das Essen kochte, hörten wir das
friedliche Rauschen des Flusses. Die Spätsommernacht war lau und
sternenklar. Manchmal fiel eine Sternschnuppe. Und jedesmal war es uns ganz
wichtig, daß der andere sie auch gesehen hatte. Zu essen gab es dann
köstliche, gesalzene Maiskolben.
|